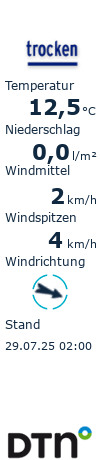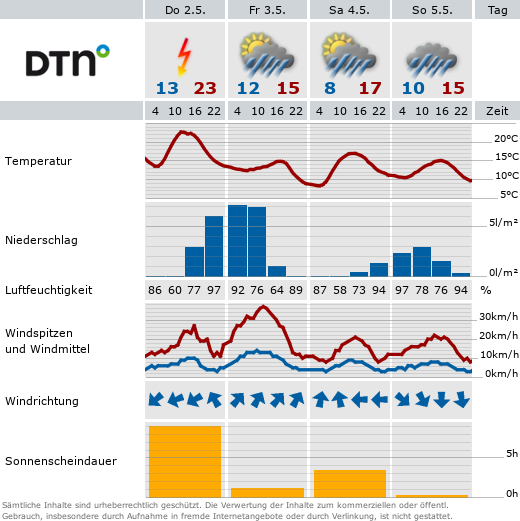Aktuelle Nachrichten und wichtige Informationen über die von unserem Lehrstuhl organisierten Veranstaltungen finden Sie hier:
Städtebau, Bauleitplanung und Stadtgestaltungsprozesse
Das Fachgebiet Städtebau, Bauleitplanung und Stadtgestaltungsprozesse beschäftigt sich in Lehre und Forschung mit aktuellen Fragestellungen der Stadtentwicklung, mit dem Wandel von Stadt und Landschaft, mit Umstrukturierungsprozessen ganzer Stadtquartiere und einzelner Standorte. Am Fachgebiet werden Städtebau, Bauleitplanung und Stadtgestaltungsprozesse integrativ miteinander verknüpft. Die Er- und Vermittlung räumlicher und vor allem städtebaulicher Qualitäten und deren Umsetzung stehen dabei im Fokus Forschung und Lehre.
Für die Transformation und Generationengerechtigkeit städtischer und ländlicher Lebensumfelder sind Städtebau und Bauleitplanung essentielle Bestandteile für die räumliche Ausprägung und Gestaltung von Raumplanung und Stadtentwicklung. Als zwei Seiten derselben Medaille bilden Städtebau und Bauleitplanung die Basis der gebauten Umwelt, die wir tagtäglich erleben: die sich im Raum ausdrückende physische und soziale Qualität und die sie bedingende normative Festsetzung. Raumplanung operiert an der Schnittstelle von Ingenieur- und Sozialwissenschaften. Städtebau wiederum bildet die Schnittstelle zu künstlerisch-kreativen Disziplinen. Für uns ist es entscheidend, diese Schnittstellen entsprechend auszubilden und die Integration interdisziplinärer Perspektiven in Forschung aber auch in der Lehre voranzutreiben.
-
Inter- und Transdisziplinarität: Städtebau ist heute schon ein interdisziplinäres Feld in dem Raum- und Stadtplaner*innen eine Querschnittsfunktion einnehmen. Um die andauernde Aufgabe der Transformation zu bewerkstelligen müssen Städte und Regionen als gemeinsame Schnittmenge vielfältiger damit befasster Disziplinen verstanden werden. Angesichts sich ausdifferenzierenden Akteurslandschaften und Spezifizierungen gilt es diese Funktion auf Basis eines vielschichtigen disziplinären Verständnisses weiter auszubauen. Am Fachgebiet StädteBauProzesse setzen wir daher auf inter- und transdisziplinäre Lehr- und Forschungskonstellationen.
-
Prozessgestaltung: Ebenso wichtig ist die Fähigkeit in dieser Schnittmenge zielführend kommunizieren zu können. Ein prozessuales Verständnis von Städtebau und Bauleitplanung wird zunehmend eine wesentliche Qualifikation von mit Stadt, Raum und Planung beschäftigten Menschen sein. Im Umgang mit den zukünftigen Herausforderungen wie Klimaanpassung, demographischer Wandel, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Umwelt- und Chancengerechtigkeit ist das Wissen über Prozessgestaltung insbesondere im Hinblick auf transversale, d.h. breit zugängliche und mitwirkungsoffene Planungsverfahren sowie der damit verknüpften Akteure und Kooperationsformen wesentlich. Es gilt diese komplexen Zusammenhänge zu verstehen, um in diese innovativ und zukunftsgewandt eingreifen zu können.
Latest News
UmBauLabor: Eröffnung
Baukultur NRW eröffnet das UmBauLabor in Gelsenkirchen

Stellenauschreibung beim LVR - Städtebauliche Denkmalpflege
Wissenschaftliche Referentin/ Wissenschaftlicher Referent (m/w/d) im Sachgebiet der Städtebaulichen Denkmalpflege der Inventarisation

Logistikhub neu denken - Städtebaulicher Ideenwettbewerb für die Stadtregion Freiburg
Im Rahmen des Modellvorhabens RegioLog werden innovative Ansätze zur interkommunalen Siedlungsentwicklung erörtert.

Auftakt: Fläche des Jahres 2024-2025
Die Fläche des Jahres geht in die nächste Runde und behandelt im Lehrjahr 2024/25 eine Aufgabe im Essener Stadtteil Bergeborbeck.

UmBauLabor: Bestehendes sichtbar machen – eine Situationsanalyse in Ückendorf
Die Untersuchungen des Bestandes und die daran anknüpfenden Ideen der Studierenden der TU Dortmund für Ückendorf sind vielfältig.

Porös-Werden
Porös-Werden
Geteilte Räume, urbane Dramaturgien, performatives Kuratieren
Herausgegeben von Barbara Büscher, Elke Krasny und Lucie Ortmann

Einsichtnahme und Remonstration des 3. Klausurtermins am 30.01.2024 | Modul 13 "Stadtgestaltung und Denkmalpflege"
Information zum Einsichtnahme und Remonstration des 3. Klausurtermins am 30.01.

Einsichtnahme und Remonstration des 2. Klausurtermins am 27.11.2023 | Modul 13 "Stadtgestaltung und Denkmalpflege"
Information zum Einsichtnahme und Remonstration des 2. Klausurtermins am 27.11.

Latest Events
Save the Dates | Städtebauliches Kolloquium SoSe 2024
"Neues Wohnen im Bestand"
Termine: 14.05.2024 | 04.06.2024 | 02.07.2024

7. Konferenz "Netzwerk Mieten & Wohnen"
"Bestandsentwicklung jetzt – für ein Umdenken in der Wohnraumversorgung" 7. Konferenz "Netzwerk Mieten & Wohnen" am 19/20.04.2024 in Hamburg.

UmBauLabor: Auftaktveranstaltung
Baukultur NRW lädt am 14. März zum Auftakt und Dialog ins UmBauLabor und in die Heilig-Kreuz-Kirche in Gelsenkirchen ein.

3. Termin – 16.01.2024 | SBP-Kolloquium "Reallabore. Lernen in 1:1 Situationen." (WiSe 2023/2024)
Mit: Christopher Dell (Spinelli Freiraum Lab), Marius Töpfer und Marieke Behne (projektbüro, Hamburg)

2. Termin – 19.12.2023 | SBP-Kolloquium "Reallabore. Lernen in 1:1 Situationen." (WiSe 2023/2024)
Mit: Stefan Kuczera, RVR, Felix Leo Matzke, ILS und Michael Kolocek, ILS

5. KoMet-Tag 2023 | Transformative Wissenschaft – Welche Rolle haben Reallabore?
Der nächste KoMet-Tag findet am 07.12.2023 ab 9.30 Uhr am Campus Essen (Glaspavillon R12 SOO H12) der Universität Duisburg-Essen statt.

1. Termin – 28.11.2023 | SBP-Kolloquium "Reallabore. Lernen in 1:1 Situationen." (WiSe 2023/2024)
Mit: Julian Petrin (Urbanista, Hamburg) und Maximilian Hoor (Reallabor Radbahn gUG, Berlin)

Save the Dates! | Städtebauliches Kolloquium WiSe 2023/2024
"Reallabore. Lernen in 1:1 Situationen"
Termine: 28.11.2023 | 19.12.2023 | 16.01.2024